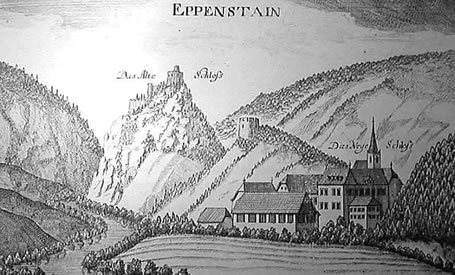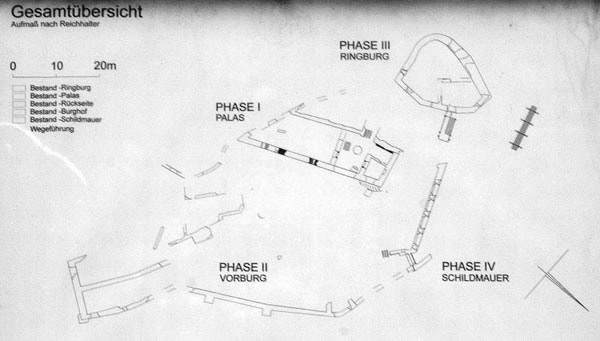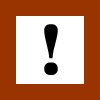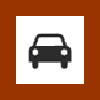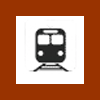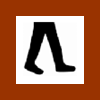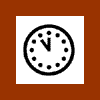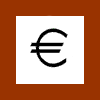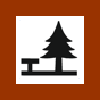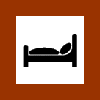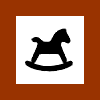|
927
|
Das Kärntner Herzoggeschlecht der Eppensteiner hat Besitzungen im Aichfeld. Wahrscheinlich wurde schon zu dieser Zeit eine erste Wehranlage errichtet. Damit wäre Eppenstein eine der ältesten Burgen in der Steiermark.
|
|
1122
|
Mit dem Tod Heinrichs III. von Kärnten erlischt das Geschlecht der Eppensteiner. Dadurch geht die Burg, mit all ihren Gütern, an die neuen Traungauer Landesfürsten.
|
|
1135
|
Lantfried von Eppenstein, einer der vornehmsten Ministerialen, wird in mehreren Urkunden erwähnt.
|
|
1160
|
Die Burg Eppenstein wird erstmals selbst urkundlich als "Castrum Eppenstein" erwähnt.
|
|
1240
|
Nach dem Aussterben dieses Zweiges des Geschlechtes fiel Eppenstein an die verwandten Wildoner.
|
|
1268
|
Anlässlich der Adelsverschwörung besetzt König Ottokar II. die Burg mit seinen böhmischen Söldnern.
|
|
1276
|
Herrand von Wildon erobert seine Burg zurück und soll dabei 17 Böhmen mit eigener Hand erschlagen haben. Nach ihm folgte Ulrich von Wildon, der sich manchmal auch von Eppenstein nannte.
|
|
1292
|
Anscheinend nimmt Ulrich von Wildon-Eppenstein nicht an dem Adelsaufstand gegen den Herzog teil, da er all seine Güter behalten darf.
|
|
1302
|
Nach dem Tod des Vaters ist auch der Sohn Wulfing von Wildon-Eppenstein gestorben und die Burg geht wieder an den Landesfürsten. Ab nun werden verschiedene Burggrafen eingesetzt.
|
|
1348
|
Die Burg wird an Paul Ramung verliehen, der sie ausbaut und vergrößert.
|
|
1478
|
Andree von Teufenbauch übernimmt gegen ein Pachtzins die Verwaltung.
|
|
1480
|
Die Türken ziehen an der mittlerweile stark befestigten Burg vorbei.
|
|
1481
|
Nach dem Tod von Andree übernimmt der Bruder Georg von Teufenbach die Verwaltung. Vermutlich wg. Erbstreitigkeiten lässt er seine eigene Schwester auf der Burg einkerkern.
|
|
1482
|
Ein Angriff der Ungarn schlägt fehl. Doch im nächsten Jahr gelingt es ihnen Eppenstein einzunehmen. Dadurch wird auch die eingekerkerte Schwester befreit.
|
|
1484
|
Ein Versuch der kaiserlichen Truppen, die Burg wieder einzunehmen, schlägt fehl. Doch auch die Bestrebungen der Ungarn, die belagerte Burg mit Lebensmitteln und Munition zu versorgen, misslingen.
|
|
1489
|
Nach mehreren Jahren Kleinkrieg konnten die Ungarn anscheinend vertrieben werden und es wird ein Verwalter eingesetzt.
|
|
1509
|
Hans von Teufenbach übernimmt für knapp 30 Jahre die Verwaltung. Anschließend wird Eppenstein von Stefan und Lukas Graswein abgelöst.
|
|
1537
|
Durch einen Brand und zuvor durch ein Erdbeben wird die Festung schwer beschädigt.
|
|
1583
|
Als der Hofvizekanzler Wolfgang Schranz die Bewilligung zur Ablöse erhält, wird Burg Eppenstein bei einer Besichtigung bereits als baufällig (in „Abödung“ gekommen) beschrieben.
|
|
1589
|
Die von der Regierung zur Instandhaltung bewilligten Gelder, werden größtenteils für den Ausbau des Meierhofes verwendet. Somit entsteht am Fuße des Burgberges Schloss Neueppenstein.
|
|
1608
|
Eppenstein wird an den Pfandbesitzer Maximilian von Schrottenbach verkauft. Die neuen Besitzer wohnen aber selbst nicht mehr auf der Burg und so begann der Verfall.
|
|
1663
|
In einer Beschreibung wird die Burg Eppenstein "das auf dem Perg liegende ruinierte alte Gschloß" genannt und der weitere Verfall schreitet rasch voran.
|
|
1958
|
Gründung des Burgvereins Ruine Eppenstein. Bis Mitte der Siebzigerjahre erste Sicherungsmaßnahmen durch freiwillige Helfer (Baum- und Strauchrodungen, Errichtung von Aufstiegshilfen usw.).
|
|
1975
|
Josef Diethard jun. übernimmt als Obmann den Burgverein. Die Instandhaltung der Aufstiegshilfen, das Offenhalten des Geländes sind permanenter Auftrag und Inhalt der Vereinsarbeit.
|
|
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente.
|
 BURG EPPENSTEIN | BURG ALT-EPPENSTEIN
BURG EPPENSTEIN | BURG ALT-EPPENSTEIN